ZIF kompakt | Ohne Frauen kein Frieden: WPS als Fundament einer resilienten Sicherheitsarchitektur
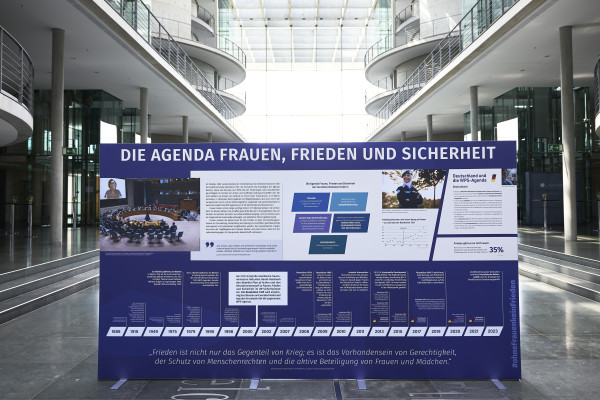 © ZIF
© ZIF
Die Verabschiedung der UN-Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ vor genau 25 Jahren markiert einen Schlüsselmoment in der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik. Seither wurden bedeutende Fortschritte erzielt – insbesondere bei der substanziellen Beteiligung von Frauen an Friedens- und Wiederaufbauprozessen sowie beim Schutz von Frauen und anderen vulnerablen Gruppen in Konflikten. Zugleich steht die Agenda zunehmend unter Druck: Ein weltweiter Backlash gegen die Rechte von Frauen und Minderheiten, verstärkt durch Desinformationskampagnen und andere hybride Bedrohungen, gefährdet ihre Umsetzung. Gerade deshalb sind die konsequente Implementierung und Weiterentwicklung der WPS-Agenda – auch im Kontext veränderter Konfliktdynamiken, neuer Akteure und der zunehmenden Spannungen in der multilateralen Zusammenarbeit – von entscheidender Bedeutung. Ihre Umsetzung ist kein feministisches Petitum, sondern eine notwendige Voraussetzung für nachhaltigen, robusten Frieden und Sicherheit für alle – mit unmittelbaren Implikationen und Gestaltungsmöglichkeiten für die deutsche Außenpolitik.
WPS: Errungenschaften & fortwährende Relevanz
Die in der UN-Resolution 1325 verankerte Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ (Women, Peace, Security) sowie ihre neun Folgeresolutionen haben bedeutende Fortschritte angestoßen. So sind etwa gender-informierte Konfliktanalysen fester Bestandteil von UN-Mandaten; die völkerrechtliche Anerkennung sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe (2008) ermöglicht die strafrechtliche Verfolgung von Täter:innen; ein geschärftes Bewusstsein für die Rolle von Frauen in Konfliktgebieten stärkt lokale Ansätze und fördert die local agency – um ein paar Beispiele zu nennen. Die Agenda WPS legt dabei einen besonderen Fokus auf präventive Ansätze in allen Konfliktphasen.
Die Datenlage zeigt eindeutig: Eine substanzielle Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen erhöht deren Wirksamkeit und verbessert langfristige Stabilität. Frauen haben oft einen guten Zugang zu unterschiedlichen sozialen Gruppen in Konfliktgebieten und können als Brückenbauerinnen fungieren. Sie spielen eine Schlüsselrolle in lokalen, regionalen und nationalen (Friedens-)Vereinbarungen. Zudem sind sie zentrale Akteurinnen in der Wirtschaft und beschleunigen den Wiederaufbau nach Konflikten (UNDP). Diese vielfältige Schlüsselrolle übersetzt sich jedoch nicht in den Zugang zu zentralen Prozessen, wie etwa Friedensverhandlungen: Im Jahr 2024 besetzten Frauen nur 7 Prozent der Verhandlungspositionen und stellten 14 Prozent der Mediatorinnen. Fast 90 Prozent der Verhandlungen fanden ohne Frauenbeteiligung statt – laut aktuellem WPS-Bericht der Vereinten Nationen. Auch haben Frauen in Krisengebieten erhebliche Benachteiligungen im Zugang zu Wirtschaft und Arbeit (UNDP).
Zugleich steht fest, dass Frauen und Mädchen vor allem in Krisenlagen besonders vulnerabel sind und besonderem Schutz bedürfen. Allein im Jahr 2023 gab es über 3.600 UN-verifizierte Fälle konfliktbasierter sexualisierter Gewalt – 95 Prozent davon verübt an Frauen und Mädchen. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher, die Täter bleiben meist straffrei. Darüber hinaus verlagern Krisensituationen oftmals die Prioritäten in den Gesundheitssystemen, sodass sexuelle und reproduktive Gesundheitsbedürfnisse häufig stark vernachlässigt werden (UNFPA). Die geringen Fortschritte bei der rechtlichen und sozialen Unterstützung von Überlebenden hemmen wiederum nicht nur die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, sondern auch das Vertrauen in die Institutionen, die Zugang zu und die Durchsetzung von Gerechtigkeit ermöglichen – was für viele der entscheidende Schritt zur Heilung traumatisierter Gemeinschaften ist. In Krisenlagen verschärfen sich bestehende Ungleichheiten für Frauen und für marginalisierte Gruppen - das Zusammenwirken von Diskriminierungsformen erhöht die Vulnerabilität zusätzlich.
Aktionspläne & Herausforderungen
Die Notwendigkeit, Frauen strategisch mitzudenken und gendersensible Faktoren für Friedensbemühungen nutzbar zu machen, unterstreichen zahlreiche Staaten in ihren Nationalen Aktionsplänen. Auch multilaterale Organisationen wie die NATO, die EU, die AU oder die OSZE haben eigene WPS-Strategien entwickelt und institutionalisiert. Die NATO integriert WPS systematisch in ihre drei Kernaufgaben* und arbeitet aktuell an einem neuen Aktionsplan für den Zeitraum 2026-2030. In der EU werden im Jahr 2026 sowohl der Gender Action Plan als auch der WPS Action Plan neu verhandelt. Die AU führt aktuell ein „Landmark Review“ zur Implementierung der WPS-Agenda durch. Die OSZE hat 2025 eine WPS-Roadmap etabliert, um die Vielzahl von WPS-Akteur:innen und -Initiativen organisationsintern besser zu koordinieren und Synergien zu stärken. ZIF-Sekundierte treiben das Thema in den multilateralen Organisationen sowohl konzeptionell als auch operativ voran. Auch die Bundesregierung erarbeitet derzeit den 4. Nationalen Aktionsplan. Die Agenda ist ausdrücklich im Koalitionsvertrag verankert.
Und dennoch - im Kontext des neuen UN-Berichts zur WPS-Agenda betont Sima Bahous, Exekutivdirektorin von UN Women: „Frauen und Mädchen werden in Rekordzahlen getötet, von den Friedenstischen ausgeschlossen und in zunehmenden Kriegen ungeschützt zurückgelassen“. Doch was hindert die Umsetzung der WPS-Agenda – die Etablierung von Mitbestimmung, Schutz und gleichberechtigter Teilhabe? Aktuell erleben Frauenrechte und feministische Bewegungen einen massiven Backlash, insbesondere in autoritären Staaten, wo der Kampf für Gleichstellung und partizipative Rechte zunehmend von Anti-Gender-Bewegungen unterminiert wird. Die Entwicklung ist Teil eines größeren globalen Trends: Populistische Strömungen gewinnen an Einfluss, autoritäre Regierungen erstarken, und die regelbasierte internationale Ordnung bröckelt. Die multilaterale Zusammenarbeit steht unter starkem Druck. Gleichzeitig erschwert eine zunehmend fragmentierte Konfliktlandschaft die Umsetzung von globalen Richtlinien – wie der WPS-Agenda. Zudem verschärft der Klimawandel bestehende Ungleichheiten und Vulnerabilitäten, fungiert so als Konflikttreiber und Katalysator (ZIF).
Der Trend zur Militarisierung von Friedensprozessen geht Hand in Hand mit einer Reduzierung der politischen und finanziellen Investitionen in zivile Konfliktbewältigung. Zu diesen sinkenden Budgets kommen verengte Handlungsspielräume, die sich auch auf die Teilhabe von Frauen auswirken: Zivilgesellschaftliche Organisationen, Aktivist:innen und Frauenrechtsbewegungen geraten zunehmend ins Visier von Desinformationskampagnen und hybriden Einflussnahmen (Queens University, CoE). Die Handlungsräume werden kleiner, die Arbeit gefährlicher. Die Komplexität macht deutlich, dass isolierte Ansätze zur Umsetzung der WPS-Agenda nicht ausreichen. Die Agenda muss als integraler Bestandteil einer umfassenden Friedens- und Sicherheitsarchitektur gedacht werden.
Handlungsimperativ
Deutschland ist starker Verfechter der WPS-Agenda und unterstützt die Implementierung auf vielfältige Weise. So ist die Bundesregierung der größte Geldgeber im Women’s Peace and Humanitarian Fund und priorisiert die WPS als übergreifendes Thema in der Peacebuilding Commission, in der Deutschland 2025 den Vorsitz innehat. Viele (UN-)Initiativen rund um WPS, wie beispielsweise die Arbeit des SRSG on Sexual Violence in Conflict, werden finanziell und politisch unterstützt. Mit der derzeitigen Ausarbeitung des vierten Nationalen Aktionsplans erneuert Deutschland sein Bekenntnis zur WPS-Agenda. Darin wird die Bundesregierung darlegen, wie sie die Geschlechterperspektive und die Eckpfeiler der Agenda (Prävention, Teilhabe, Schutz, Hilfe und Wiederaufbau) weiter in ihre weltweite Arbeit für Frieden und Sicherheit integrieren wird.
Das multilaterale Engagement für internationalen Frieden und Sicherheit ist sehr komplex, und die deutschen Politikfelder (Innen-, Außen-, Wirtschafts-, Verteidigungspolitik) sind eng verwoben (Bundesregierung). Es ist somit essenziell, dass WPS als strategisches Querschnittsthema verankert und konsequent mitgedacht wird. So plädiert das GCSP beispielsweise für eine Integration von Gender-Perspektiven in Initiativen zur Weltraumsicherheit, während das CoE betont, dass WPS eine zunehmende Rolle in der Innenpolitik von EU-Mitgliedsstaaten spielt. Wie bereits erwähnt, müssen komplexe Verzahnungen, u.a. zwischen Klimawandel, Machtverhältnissen, Gewaltmechanismen und hybriden Bedrohungen berücksichtigt werden. Ein konsequentes Mainstreaming in allen relevanten Politikfeldern stärkt Synergien, Wirkung und Effizienz. Die Agenda muss Teil von Standard Operating Procedures werden und auch Eingang in die Themen des neuen Nationalen Sicherheitsrates finden.
Dafür braucht es Maßnahmen zur Stärkung des Bewusstseins in der Politik und Gesellschaft sowie gezielte Trainingsformate. Akteur:innen im Bereich der Außen-, Innen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik müssen ihren „WPS-Reflex“ stärken und das Thema systematisch mitdenken. Das bedeutet auch, dass das Verständnis für die normativen Grundlagen der Agenda – die vielfältigen Dimensionen von Frieden und Gewalt, Intersektionalität sowie präventive Ansätze – geschärft werden muss. Monitoring, Evaluierung und kontinuierlicher Wissenstransfer tragen dazu bei, erfolgreiche Ansätze sichtbar zu machen und weiterzugeben. So könnte Deutschland gemeinsam mit Partnern Leuchtturmprojekte identifizieren und strategisch unterstützen.
Ein konsequentes WPS-Engagement erfordert die gezielte Stärkung von Allianzen und Partnerschaften – insbesondere mit Akteur:innen im Globalen Süden sowie mit Frauen-geführten und inklusiven Friedensbewegungen. Gleichzeitig müssen Verzahnungen und Synergien mit multilateralen Institutionen wie EU, UN oder OSZE systematisch sichergestellt werden, um koordinierte, wirksame Maßnahmen zu ermöglichen. Alle Maßnahmen – Schutz, Teilhabe, Kapazitätsaufbau und Monitoring – benötigen ausreichende und verlässliche Finanzierung. Frauen, sowohl als Akteurinnen als auch als Betroffene, sind besonders von Mittelkürzungen betroffen. Deshalb ist flexible, langfristige Finanzierung für lokale Organisationen im Bereich Frauenrechte und Friedensförderung von entscheidender Bedeutung.
WPS ist kein Nebenprojekt: Die Umsetzung der Agenda bildet einen sicherheitspolitischen Anker und Katalysator. Entsprechend müssen sicherheitspolitische Budgets kohärent genutzt werden, um WPS auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene nachhaltig zu stärken. Die Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ ist kein Paradigmenwechsel – aber sie bleibt ein strategisches Fundament für eine resiliente Sicherheitsarchitektur.