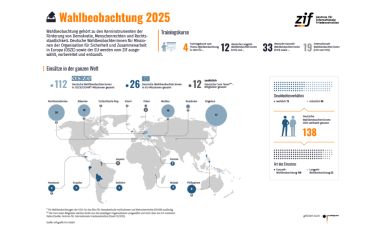ZIF kompakt | Kosovo Force 2024: Erhöhte Bereitschaft im Jahr der Wahlen

Auch im Westbalkan werfen die Europa- und US-Wahlen ihren geopolitischen Schatten voraus. Dies erhöht das Konfliktpotential, zumal der EU-vermittelte Dialog zwischen Belgrad und Prishtina einen toten Punkt erreicht hat. Serbien – unterstützt von russischen Einflussoperationen – agiert zunehmend revanchistisch, beschwört eine „Serbische Welt“ und setzt offensichtlich auf den Sieg Donald Trumps. Kosovo versucht, bis zur US-Wahl seine Staatlichkeit maximal zu stärken, stößt dabei aber seine serbische Minderheit und die internationale Gemeinschaft vor den Kopf. In diesem Umfeld braucht die Kosovo Force (KFOR) die Fähigkeit, Eskalationen abzuschrecken und im Notfall robust einzugreifen. Nach der Europawahl steht die EU vor der Herausforderung, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.
Mandat, Aufstellung und deutscher Beitrag zu KFOR
Die NATO-geführte KFOR wuchs im letzten Jahr von 3.760 auf 4.440 Einsatzkräfte aus 24 NATO- und vier Nicht-NATO-Staaten auf (Stand Januar 2024). Größte Truppensteller sind Italien (1322), die USA (572), Ungarn (365), Türkei (352), Österreich (289) und Polen (210). KFOR soll ein sicheres Umfeld und die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung Kosovos gewährleisten. Völkerrechtliche Grundlage ist die UN-Resolution 1244 vom 10. Juni 1999. Befehlshaber ist der türkische Generalmajor Özkan Ulutaş.
Gegenwärtig sind rund 300 Bundeswehrangehörige dauerhaft im KFOR-Einsatz, seitdem im April 2024 eine neue Einsatzkompanie den Abzug einer österreichischen Kompanie kompensiert. Die Mandatsverlängerung sieht vor, die Obergrenze von 400 Einsatzkräften unverändert beizubehalten; vorübergehend kann sie auch überschritten werden.
Eskalationsgefahr im Zeichen der Geopolitik
Trotz aller diplomatischen Bemühungen liegt das Abkommen zwischen Belgrad und Prishtina, das die EU am 18. März 2023 im nordmazedonischen Ohrid vermittelte, weitgehend auf Eis. Einzig die gegenseitige Anerkennung der Kfz-Kennzeichen Anfang 2024 kann als Erfolg verbucht werden. Die wichtigsten Punkte stehen aber aus: die gegenseitige Anerkennung der territorialen Integrität, der Verzicht auf den Anspruch, die jeweils andere Seite international zu repräsentieren oder ihren Beitritt in internationale Organisationen zu behindern sowie ein „self-management“ der serbischen Gemeinschaft im Kosovo.
Während sich Kosovos Premierminister Albin Kurti am 09. Februar 2024 im UN-Sicherheitsrat bereit erklärte, das Abkommen zu unterzeichnen, lehnt Serbiens Präsident Aleksander Vučić dies vehement ab und versäumt kaum eine Gelegenheit, den Glauben an seine Vertragstreue zu untergraben. Im Dezember 2023 erklärte Serbiens Regierung schriftlich, dass das Abkommen keine völkerrechtliche Bindung besäße und nur selektiv umgesetzt würde. Ein Problem des Abkommens ist die fehlende zeitliche Abfolge (sequencing) seiner Maßnahmen. Die EU-Vermittler dringen vornehmlich auf die Einrichtung eines Verbands der serbischen Mehrheitsgemeinden (self-management). Kosovos Regierung fürchtet, hier ein wesentliches Zugeständnis zu machen, ohne Garantien für die vereinbarten Gegenleistungen zu haben; der Verband könne somit zum Vehikel Serbiens werden, Kosovos Staatlichkeit zu untergraben.
Belgrad betrieb auch eine Kampagne gegen Kosovos Streben, dem Europarat beizutreten, und erhielt dabei rhetorische Schützenhilfe aus Russland. Nachdem das Politische Komitee des Europarats die Aufnahme Kosovos empfahl, bezichtigte Vučić dessen Vorsitzende Dora Bakoyannis der „Schande“ und drohte mit dem Austritt Serbiens. Dies konnte aber einen positiven Beschluss der Parlamentarischen Versammlung am 17. April 2024 nicht verhindern. Doch die Weigerung der Regierung Kurti, einen Entwurf der europäischen Vermittler zur Einrichtung des Verbands der serbischen Mehrheitsgemeinden vom Verfassungsgericht prüfen zu lassen veranlasste Deutschland, Frankreich und Italien zu einer Intervention, den Beitrittsantrag nicht auf die Agenda des Ministerrats am 17. Mai zu setzen.
Ungebrochene Eskalationsdynamik?
Um gegen die Einführung der offiziellen Kfz-Kennzeichen zu protestieren, hatte die eng mit Belgrad verbundene Srpska Lista, die dominante serbische Partei im Kosovo, im November 2022 den Rücktritt aller serbischen Funktionsträger Kosovos initiiert. Auch die Kommunalwahlen im April 2023 wurden auf Geheiß Belgrads boykottiert, so dass sich erstmals vier ethnische Albaner als Bürgermeister im Nordkosovo durchsetzten. Als diese unter Polizeischutz ihre Amtsräume übernahmen, kam es zu gewaltsamen Protesten serbischer Akteure, bei denen über 90 KFOR-Kräfte teilweise schwer verletzt wurden. Um zu deeskalieren, forderte die EU den sofortigen Abzug der Polizei, die Beschäftigung der Bürgermeister an anderem Ort und abermalige Neuwahlen. Premierminister Kurti verfolgte dagegen einen graduellen Abzug und bestand auf Wahlverfahren im Rahmen des geltenden Rechts. Daraufhin verhängte die EU „Maßnahmen“, mit denen sie hochrangige Kontakte und finanzielle Hilfen aussetzte.
Ende September 2023 kam es im Norden Kosovos zum bislang gravierendsten Sicherheitsvorfall. Eine Polizeistreife überraschte eine schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die einen Polizisten tötete und sich im Kloster Banjska verschanzte. Dem folgenden Feuergefecht fielen drei Paramilitärs zum Opfer, andere flohen über die Grenze nach Serbien. Dort übernahm Milan Radojčić – ein in die organisierte Kriminalität verquickter Vize-Vorsitzender der Srpska Lista – die alleinige Verantwortung. Er wurde in Belgrad festgenommen, aber nach zwei Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt – während Serbiens Regierung im Gedenken an die getöteten Paramilitärs einen Tag der Trauer ausrief. Gleichzeitig warf Präsident Vučić der Regierung Kosovos „Terror“ vor, beschuldigte Teile der internationalen Gemeinschaft, ethnische Säuberungen zu unterstützen, und drohte mit einer militärischen Intervention.
Kosovo begegnet dem (und einer als Appeasement wahrgenommenen westlichen Politik gegenüber Belgrad) mit Anstrengungen, noch vor dem ungewissen Ausgang der US-Wahlen die Staatlichkeit im Norden Kosovos zu festigen – so durch eine dauerhafte Polizeipräsenz und die Durchsetzung des Euro als einziges legales Zahlungsmittel. Dabei ließ es die Regierung aber sowohl an einer Abstimmung mit ihren internationalen Partnern als auch der Kommunikation gegenüber der betroffenen serbischen Bevölkerung missen. Unterstützt von Vučić rief die Srpska Lista zum Boykott des laufenden Zensus und des von der Regierung angesetzten Referendums zur Abwahl der vier Bürgermeister auf; letzteres scheiterte deshalb am 21. April 2024.
Fazit: Robuste Prävention notwendig
Bis Ende 2023 wurde KFOR um 500 türkische, 200 britische und 130 rumänische Einsatzkräfte verstärkt. Vor allem an der Nordgrenze wird seitdem stärker patrouilliert. Angesichts des aktuellen Umfelds ist es entscheidend, dass KFOR Eskalationen glaubhaft abschrecken und im Ernstfall robust reagieren kann.
Nach der Europawahl werden der EU-Außenbeauftragte und sein Sondergesandter neu berufen. Dann gilt es, verlorenes Vertrauen in das Ohrider Abkommen wiederherzustellen. Da sich die Einigung ohne Unterschrift als nicht tragfähig erwiesen hat, braucht es schriftliche Verbindlichkeiten. Auch eine ausgewogene Sequenz der vereinbarten Maßnahmen ist nötig. Vertrauen muss aber auch die europäische Vermittlung zurückgewinnen. Sanktionierende „Maßnahmen“ wurden ausschließlich gegen Kosovo verhängt. Dagegen vermeidet die EU eine klare Sprache zur Rolle Serbiens bei den Eskalationen des Vorjahres. Es geht auch darum, dass die Bilanz von über 90 verletzten KFOR-Truppen nicht straflos bleibt.