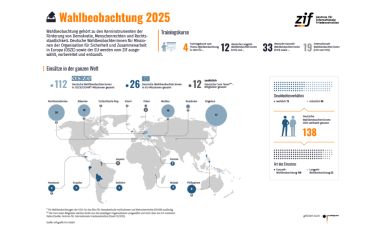ZIF kompakt | Monitoring in unruhigen Zeiten: Die EUMM in Georgien
 © CSDP EEAS
© CSDP EEAS
Die EUMM-Mission in Georgien hat seit 2008 als einzige verbliebene zivile Beobachtungsmission entscheidend zur Stabilisierung des Landes beigetragen. Die jüngsten politischen Entwicklungen, so die umstrittenen Parlamentswahlen und die zunehmend autoritäre und anti-europäische Ausrichtung der Regierung, könnten die Mission vor ganz neue Herausforderungen stellen. Ähnlich wie in den Ländern der Sahel-Region könnte sich die grundsätzliche Frage stellen, wie eine Mission im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) sich in einem Land verhält, dessen Regierung sich zunehmend antagonistisch zu dessen Entsender verhält. Da die EUMM auf Einladung Georgiens tätig ist, besteht die Gefahr, dass die Regierung des Georgischen Traums (GD) im Falle einer weiteren Eskalation in den Beziehungen zur EU diese Einladung zurückziehen könnte. Aktuell betreibt die EUMM wichtige De-Eskalations- und Kommunikationskanäle, insbesondere den Incident Prevention and Response Mechanism (IPRM) und die Hotline zwischen Georgien, seinen Regionen Abchasien und Südossetien sowie Russland. Daher ist es zu begrüßen, dass der Europäische Rat bereits am 2. Dezember 2024 die Mission um zwei weitere Jahre unverändert verlängert hat.
EUMM Georgien
Im Jahr 2008 wurde die European Monitoring Mission in Georgien (EUMM) ins Leben gerufen, um als zivile Beobachtermission im innergeorgischen Konflikt zwischen dem Kernland und den abtrünnigen Gebieten sowie Russland zu agieren. Ihre Aufgabe ist es, die Umsetzung des von der EU vermittelten 6-Punkte-Abkommens zu überwachen, das den Augustkrieg 2008 beendete. Dieser bewaffnete Konflikt dauerte fünf Tage und forderte 850 Opfer. Durch den Konflikt verlor Georgien die Kontrolle über die letzten noch von Tiflis kontrollierten Gebiete in den seit den frühen 1990er Jahren abtrünnigen Regionen. Die Verwaltungsgrenzen (ABL) zu beiden Regionen werden seitdem durch die dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB unterstellten Grenztruppen kontrolliert.
Seit Oktober 2008 sind etwa 200 Beobachter:innen aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten vor Ort, um die Einhaltung des Waffenstillstands zu überwachen und zur Stabilisierung sowie Normalisierung der Situation nach dem Krieg beizutragen. Deutschland sekundiert aktuell knapp 30 zivile Expert:innen und Polizeibeamte in die Mission. Bei der Mandatsumsetzung stützt sich die Mission vor allem auf zwei Mechanismen: Eine rund um die Uhr betreute Hotline der EUMM verbindet georgische, abchasische, südossetische und russische Sicherheitsakteure und ermöglicht eine zeitnahe Kommunikation aller konfliktbezogenen Vorfälle. Darüber hinaus gibt es den IPRM, der sich mit Sicherheitsthemen befasst. Der IPRM in Ergneti, an dem die georgischen und russischen Vertreter:innen sowie die südossetischen de facto-Behörden teilnehmen, wird gemeinsam von der EUMM und der OSZE moderiert. Der IPRM zu Abchasien, an dem georgische, russische und abchasische Vertreter:innen teilnahmen, wurde in Gali von der UN mit Unterstützung der EUMM durchgeführt, ist aber bereits seit sechseinhalb Jahren von Abchasien ausgesetzt. Nach mehr als anderthalb Jahrzehnten ist die EUMM ein akzeptierter Kooperationspartner für die Konfliktparteien vor Ort und genießt bei der Bevölkerung hohe Zustimmung. Die aktuellen innergeorgischen Entwicklungen könnten jedoch Auswirkungen auf die Arbeit der Mission haben, sowohl was die Beziehung zur georgischen Seite betrifft als auch die Stabilität entlang der ABL.
Wahlen 2024
Die Parlamentswahlen am 26. Oktober 2024 waren die ersten Wahlen, seit Georgien im Dezember 2023 der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt wurde. Der Wahlkampf war geprägt von starker Polarisierung zwischen der Regierung und der pro-europäischen Opposition sowie Staatspräsidentin Salome Surabischwili. Die seit 2012 regierende Partei Georgischer Traum (GD) verfolgt einen autoritären und, in den Augen der Opposition, russlandfreundlichen Kurs und inszenierte die Wahlen als Entscheidung zwischen „Frieden und Krieg“. Zuvor hatte die Regierung eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, wie beispielsweise das „Gesetz über die Transparenz ausländischer Einflussnahme“, die massive Proteste in der Bevölkerung auslösten und im gravierenden Widerspruch zu den Werten der EU stehen. Die EU-Kommission erklärte das Vorgehen der Regierung als „Rückschritt“ und legte die Beitrittsverhandlungen im Juni 2024 vorerst auf Eis.
Am Wahltag kam es zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten. Nationale und internationale Beobachter:innen, u.a. die Beobachtungsmission der OSZE wiesen auf Überfüllung in Wahllokalen, Einschüchterung von Wähler:innen und örtlichen Wahlbeobachter:innen, Verletzung der geheimen Wahl und auf mehrere Vorfälle von körperlichen Auseinandersetzungen vor Wahllokalen hin. Die zentrale Wahlkommission erklärte den GD mit knapp 54 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger. Surabischwili und die pro-westliche Opposition erkennen das Ergebnis wegen angeblicher Wahlmanipulation und russischem Einfluss nicht an. Surabischwili beantragte mit 30 anderen Oppositionsvertreter:innen beim georgischen Verfassungsgericht die vollständige Annullierung der Wahl.
Am 25. November 2024 trat das neue georgische Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammen, jedoch nur mit GD-Abgeordneten und ohne die Opposition. Die konstituierende Sitzung hätte eigentlich erst nach der noch anhängigen Klage beim Verfassungsgericht stattfinden dürfen und wurde auch nicht – wie in der Verfassung vorgesehen – vom Staatsoberhaupt einberufen. Dass der Georgische Traum nicht auf diese Entscheidung warten wollte, hing auch mit der Präsidentschaftswahl nach neuem Wahlgesetz zusammen – nach dem der Präsident erstmalig durch ein Wahlkollegium aus Parlamentsabgeordneten und Parteivertreter:innen der örtlichen Selbstverwaltungsorgane gewählt wird und nicht mehr vom Volk.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen entschied das EU-Parlament bereits am 28. November mit großer Mehrheit, die Parlamentswahlen nicht anzuerkennen und international überwachte Neuwahlen zu fordern. Noch am selben Tag verkündete Premierminister Irakli Kobachidse, dass Georgien die EU-Beitrittsverhandlungen bis Ende 2028 aussetzen und keine EU-Fördermittel mehr annehmen werde. Diese Entscheidung führt seitdem zu landesweiten Protesten, die von der Regierung mit massiver Gewalt beantwortet werden. Am 03.12. lehnte das georgische Verfassungsgericht die Klage von Surabischwili ab und erklärte die Wahlen für gültig. Mit der Wahl des rechtspopulistischen ehemaligen Fußballers Mikheil Kawelaschwili zum Präsidenten am 14.12. geht die Auseinandersetzung zwischen dem GD und der Opposition in die nächste Runde. Präsidentin Salome Surabischwili hat bereits angekündigt, ihren Amtssitz zur Amtseinführung von Kawelaschwili am 29.12. nicht räumen zu wollen. Am 16.12 kündigte die EU als Reaktion einzelne Sanktionen gegen Georgische Offizielle an.
Abchasien, Südossetien und das Schwarze Meer
Bislang haben diese Ereignisse keine sichtbaren Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Georgien und seine abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien gehabt. Obwohl in jüngster Zeit zwei weitere Runden der Genfer Internationalen Diskussionen zwischen Tbilisi, Moskau und den de facto Regierungen in Sukhumi und Tskhinvali abgehalten wurden, drehten sich diese lediglich um die bereits bekannten, festgefahrenen Positionen aller Beteiligten. Im Rahmen des IPRM für Südossetien wurde das 122. Treffen am 19.11.2024 abgehalten. Vor diesem Hintergrund erneuerten die EUMM und die OSZE ihre Forderung nach einer vollständigen Wiedereröffnung der Passierstellen an den ABL für den regulären Verkehr und forderten die Einstellung der Praxis von Verhaftungen und Inhaftierungen wegen angeblicher „Grenzverletzungen“.
Südossetien verfolgt konsequent eine Politik der Selbstisolation gegenüber Georgien und der internationalen Gemeinschaft. Gleichzeitig verstärkt Russland seine Strategie, den Einfluss in der Region auszuweiten. Seit 2008 wurden Berichten zufolge mindestens 30 Militärbasen vom russischen Grenzschutz und Sicherheitskräften errichtet, und es kommt weiterhin zu Festnahmen und Gewalt an der ABL sowie zur Diskriminierung ethnischer Georgier:innen. Parallel setzen auch die abchasischen Behörden immer stärker auf Druck gegen internationale Akteure und schränken die Aktivitäten der Zivilgesellschaft und der politischen Opposition ein. Die innenpolitische Polarisierung in Abchasien nimmt angesichts der klaren Tendenz der de facto Regierung, eine stärkere Integration mit Russland anzustreben, weiter zu. Zuletzt gab es Massendemonstrationen gegen ein pro-russisches Investitionsgesetz. In der Folge trat Aslan Bschania als Präsident von Abchasien zurück – Präsidentschaftswahlen waren bereits vor seinem Rücktritt für den Februar 2025 geplant. Eine potenzielle Annäherung an Russland durch die georgische Regierungspartei könnte in Abchasien und Südossetien zu neuen Befürchtungen führen, dass Tbilisi und Moskau hinter ihrem Rücken eine Konfliktlösung vereinbaren könnten. Eine solche Entwicklung könnte einen direkten georgisch-abchasischen sowie georgisch-ossetischen Dialog noch unwahrscheinlicher machen.
Parallel dazu bleiben geopolitische Spannungen im Schwarzen Meer bestehen. Im November 2023 wurde ein Abkommen zwischen Russland und Abchasien unterzeichnet, das die Errichtung einer dauerhaften russischen Marinebasis in Otschamtschire vorsieht. Für Russland könnte der Hafen vor allem als Basis für die Schwarzmeerflotte von Bedeutung sein und somit als strategischer Standort für eine weitergehende Phase der russischen Einflussnahme im Schwarzen Meer fungieren. Darüber hinaus könnte er eine Möglichkeit darstellen, den Druck auf Georgien weiter zu intensivieren.
Ausblick
Die EUMM durchläuft aktuell einen sogenannten Strategic Review – einen internen Überprüfungsprozess durch den Europäischen Auswärtigen Dienst, dem alle Missionen regelmäßig unterworfen sind. Nicht alle Empfehlungen der letzten Review sind umgesetzt worden, darunter die Vorschläge Personal zu kürzen oder Feldbüros zusammen zu legen. Das könnte daher wieder das Ergebnis der aktuellen Runde sein. Die offizielle Verlängerung des Mandats um weitere zwei Jahre ist gerade erfolgt, allerdings wird es wohl keine großen inhaltlichen Änderungen in der Umsetzung geben. Eine Ausnahme könnte die weitere Stärkung der noch immer recht neuen Mandatsaufgaben Kulturgüterschutz und Klima-/Umweltsicherheit sowie des (bereits vom Feldbüro Zugdidi der EUMM aufgenommenen) Monitoring der Schwarzmeerregion, insbesondere des erwähnten abchasischen Hafens Otschamtschire sein.
Auch wenn das Mandat der Mission keinen direkten Bezug zu innenpolitischen Themen hat, so ist die Verlängerung bis Ende 2026 und die weitere Arbeit der EUMM auch für die Stabilisierung Georgiens ein wichtiger Beitrag. Obwohl der GD als russlandfreundlich gesehen wird, kann ein Abzug der EUMM nicht in seinem Interesse sein – ausgeschlossen ist eine solche Entwicklung, also die Rücknahme der georgischen Einladung für die Mission jedoch nicht. Diese hätte unabsehbare Folgen für die Stabilität der Region, und könnte - ohne die dann noch vorhandenen Deeskalationsinstrumente der EUMM – zu ernsten Zwischenfällen an der Verwaltungsgrenze zu den beiden abtrünnigen Regionen führen. Für die EU ist die weitere Präsenz der EUMM in Georgien auch von strategischem Interesse, u.a. für das Monitoring russischer Aktivitäten in diesen Regionen sowie im Schwarzen Meer. Daher sollte die EU die EUMM vor den aktuellen Auseinandersetzungen mit dem GD möglichst schützen.
Wahlen 2024
Die Parlamentswahlen am 26. Oktober 2024 waren die ersten Wahlen, seit Georgien im Dezember 2023 der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt wurde. Der Wahlkampf war geprägt von starker Polarisierung zwischen der Regierung und der pro-europäischen Opposition sowie Staatspräsidentin Salome Surabischwili. Die seit 2012 regierende Partei Georgischer Traum (GD) verfolgt einen autoritären und, in den Augen der Opposition, russlandfreundlichen Kurs und inszenierte die Wahlen als Entscheidung zwischen „Frieden und Krieg“. Zuvor hatte die Regierung eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, wie beispielsweise das „Gesetz über die Transparenz ausländischer Einflussnahme“[1], die massive Proteste in der Bevölkerung auslösten und im gravierenden Widerspruch zu den Werten der EU stehen. Die EU-Kommission erklärte das Vorgehen der Regierung als „Rückschritt“ und legte die Beitrittsverhandlungen im Juni 2024 vorerst auf Eis.
Am Wahltag kam es zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten. Nationale und internationale Beobachter:innen, u.a. die Beobachtungsmission der OSZE wiesen auf Überfüllung in Wahllokalen, Einschüchterung von Wähler:innen und örtlichen Wahlbeobachter:innen, Verletzung der geheimen Wahl und auf mehrere Vorfälle von körperlichen Auseinandersetzungen vor Wahllokalen hin.[2] Die zentrale Wahlkommission erklärte den GD mit knapp 54 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger. Surabischwili und die pro-westliche Opposition erkennen das Ergebnis wegen angeblicher Wahlmanipulation und russischem Einfluss nicht an. Surabischwili beantragte mit 30 anderen Oppositionsvertreter:innen beim georgischen Verfassungsgericht die vollständige Annullierung der Wahl.
Am 25. November 2024 trat das neue georgische Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammen, jedoch nur mit GD-Abgeordneten und ohne die Opposition. Die konstituierende Sitzung hätte eigentlich erst nach der noch anhängigen Klage beim Verfassungsgericht stattfinden dürfen und wurde auch nicht – wie in der Verfassung vorgesehen – vom Staatsoberhaupt einberufen. Dass der Georgische Traum nicht auf diese Entscheidung warten wollte, hing auch mit der Präsidentschaftswahl nach neuem Wahlgesetz zusammen – nach dem der Präsident erstmalig durch ein Wahlkollegium aus Parlamentsabgeordneten und Parteivertreter:innen der örtlichen Selbstverwaltungsorgane gewählt wird und nicht mehr vom Volk.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen entschied das EU-Parlament bereits am 28. November mit großer Mehrheit, die Parlamentswahlen nicht anzuerkennen und international überwachte Neuwahlen zu fordern. Noch am selben Tag verkündete Premierminister Irakli Kobachidse, dass Georgien die EU-Beitrittsverhandlungen bis Ende 2028 aussetzen und keine EU-Fördermittel mehr annehmen werde. Diese Entscheidung führt seitdem zu landesweiten Protesten, die von der Regierung mit massiver Gewalt beantwortet werden. Am 03.12. lehnte das georgische Verfassungsgericht die Klage von Surabischwili ab und erklärte die Wahlen für gültig. Mit der Wahl des rechtspopulistischen ehemaligen Fußballers Mikheil Kawelaschwili zum Präsidenten am 14.12. geht die Auseinandersetzung zwischen dem GD und der Opposition in die nächste Runde. Präsidentin Salome Surabischwili hat bereits angekündigt, ihren Amtssitz zur Amtseinführung von Kawelaschwili am 29.12. nicht räumen zu wollen. Am 16.12 kündigte die EU als Reaktion einzelne Sanktionen gegen Georgische Offizielle an.